Gebärmutterkörperkrebs
Die oberen zwei Drittel der Gebärmutter werden als GebärmutterKÖRPER (Corpus) bezeichnet, und das untere Drittel als GebärmutterHALS (Zervix), der in den Muttermund (Portio) übergeht.
Rund 90% der Krebserkrankungen des Gebärmutterkörpers (Corpus uteri) nehmen ihren Ausgang von den Drüsen in der Schleimhaut, die die Gebärmutterhöhle (Cavum uteri) auskleidet. Dieser bösartige Tumor wird deshalb als Gebärmutterkörper- oder Gebärmutterhöhlen-Krebs und in der Fachsprache als Endometrium- bzw. Corpuskarzinom bezeichnet.
Da Symptome frühzeitig auftreten, wird Gebärmutterkörperkrebs in aller Regel in einem frühen Stadium diagnostiziert. Das frühe Hauptsymptom ist eine nicht-reguläre Blutung aus der Scheide, die allerdings auch andere Ursachen haben kann. Eine ärztliche Abklärung solcher nicht-regulären Blutung ist daher sehr wichtig.
Die Diagnose von Gebärmutterkörperkrebs erfolgt durch eine feingewebliche Untersuchung (Histologie) des Schleimhautgewebes, das mittels Ausschabung der Gebärmutterhöhle (Curettage) nach vorheriger Gebärmutterspiegelung (Hysteroskopie) gewonnen wird. Sollte Gebärmutterkörperkrebs histologisch diagnostiziert worden sein, kann eine weiterführende Bildgebung (wie Lungenröntgen, CT, MR etc.) notwendig sein.
Die Behandlung sollte in spezialisierten Zentren erfolgen – eine Auflistung der zertifizierten gynäkologischen Zentren in Österreich finden Sie hier.
Die Therapie der Wahl ist die operative Entfernung der Gebärmutter sowie der Eierstöcke und Eileiter. In seltenen Fällen kommen andere Therapiemöglichkeiten zum Einsatz.
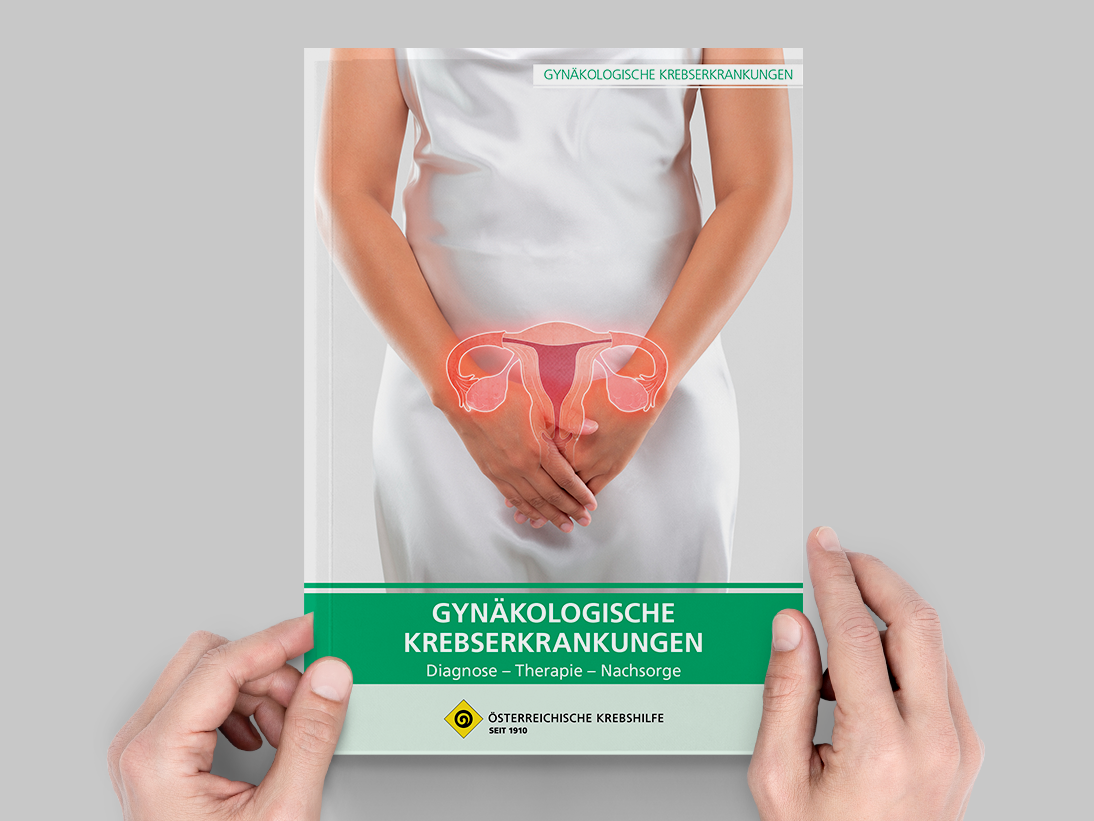
Broschüre Gynäkologische Krebserkrankungen
Ausführliche Informationen zu Diagnose, Therapie und Nachsorge von Gebärmutterkörperkrebs erhalten Sie in der Krebshilfe-Broschüre "Gynäkologische Krebserkrankungen".
Seit einigen Jahren können sich Krankenhäuser mit viel Erfahrung in der Behandlung von Unterleibskrebs als „Zentrum für Gynäkologische Tumoren“ zertifizieren lassen. Die Behandlung von Gebärmutterkörperkrebs sollte in solchen Zentren erfolgen.
