Blasenkrebs
Ungefähr 95% der bösartigen Krebserkrankungen der Blase gehen von der Blasenschleimhaut, dem sogenannten Übergangsepithel („Urothel“) aus. Bösartige Tumorerkrankungen anderer Art, wie das Plattenepithelkarzinom, Adenokarzinom oder neuroendokrine Tumore der Harnblase sind selten.
Blasenkrebs tritt meistens ab dem 6. Lebensjahrzehnt auf. Der wichtigste Risikofaktor ist Tabakrauch(en), der für ca. die Hälfte der Fälle von Blasenkrebs verantwortlich ist.
Je früher ein Harnblasenkarzinom erkannt wird und je weniger es aus der oberflächlichen Urothelschicht in tiefere Schichten der Harnblasenwand infiltriert, umso günstiger ist die Prognose.
Entscheidend für die Wahl der Therapie sind in erster Linie das Tumorstadium sowie das Alter und der allgemeine Gesundheitszustand des Patienten/der Patientin. Zur Auswahl stehen die operative Entfernung des Harnblasentumors, die operative Total-Entfernung der Harnblase mit Bildung eines neuen Urinreservoirs, Chemotherapie, Strahlentherapie oder eine Kombination dieser Therapien.
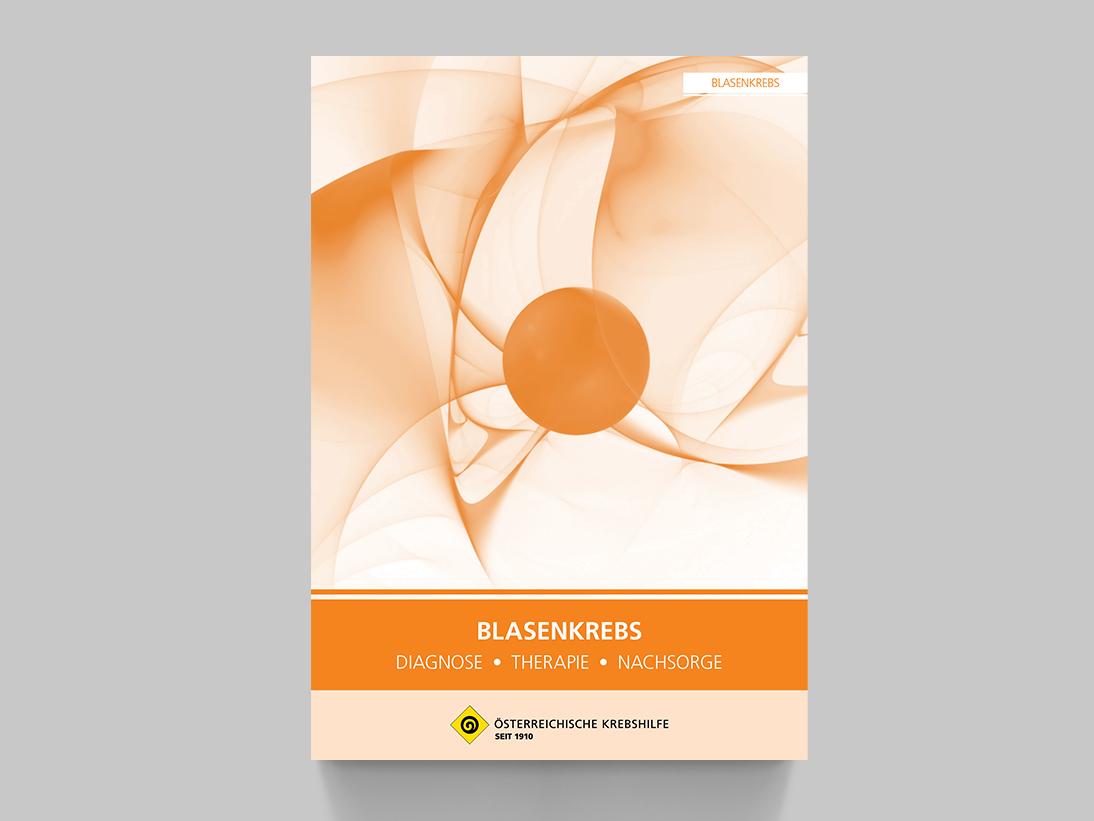
Broschüre Blasenkrebs
Ausführliche Informationen zu Symptomen, Diagnose, Therapie und Nachsorge von Blasenkrebs erhalten Sie in der gleichnamigen Krebshilfe-Broschüre.
